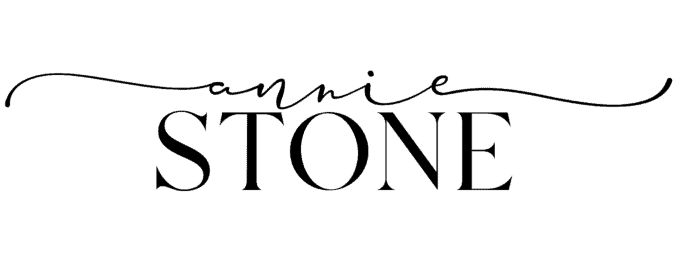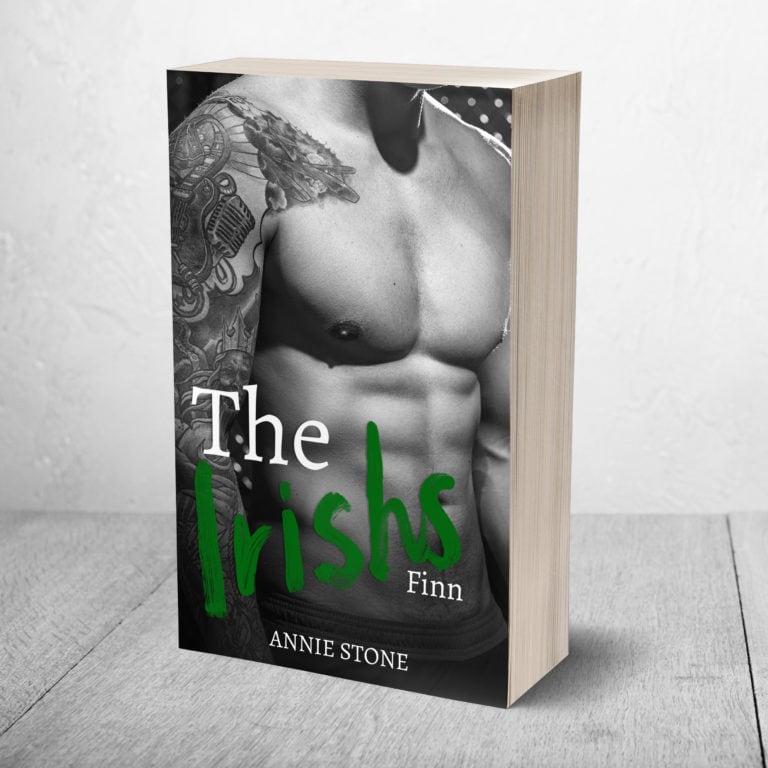Find me in Guerneville
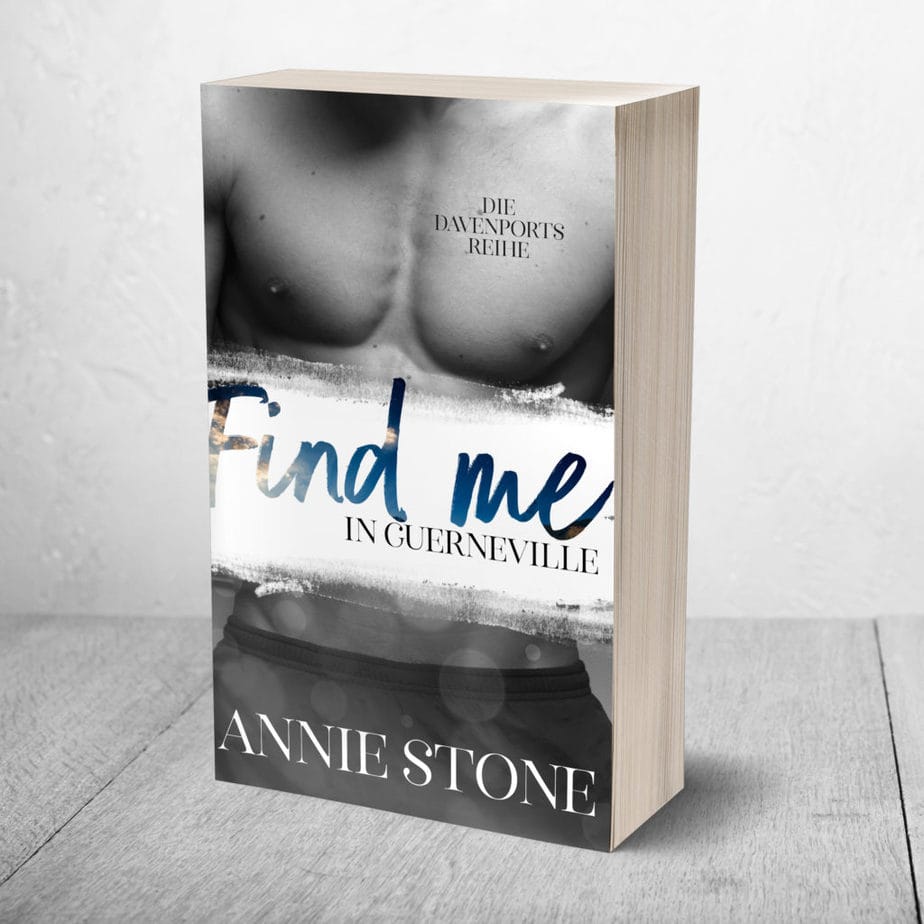
Content Note: Dieses Buch behandelt Alkoholismus und Gewalt.
Kapitel 1
Tarryn
Ich bin wie vor den Kopf gestoßen. Fassungslos starre ich meinen Chef an. »Ist das Ihr Ernst?« Meine Stimme hört sich nicht so an wie meine eigene. Irgendwas fühlt sich zerbrochen an, auch wenn das dramatisch klingen mag.
»Natürlich ist das mein Ernst. Mein voller Ernst.« Er schnaubt und wenn wir in einem Cartoon wären, würde jetzt Rauch aus seinen Nüstern kommen. So wütend habe ich ihn noch nie gesehen.
»Aber … Es muss doch … es muss doch eine Möglichkeit geben, das anders zu regeln.« Meine Augen sind so weit aufgerissen, dass es mich wundert, dass sie mir nicht aus dem Kopf fallen. Aber das, was er mir gerade eröffnet hat, schockiert mich so sehr, dass ich mich selbst nicht mehr kenne.
»Was haben Sie denn geglaubt? Dass Ihre Tat keine Konsequenzen haben würde?«
Nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen. Das ist alles, was ich mir vorsage. Ich bin nicht der emotionale Typ, aber ich sehe hier gerade mein Lebenswerk – und mir ist bewusst, dass man das mit dreißig kaum sagen kann – den Abfluss runterfließen. Eine solche Katastrophe epischen Ausmaßes kann man schon mal mit Tränen begleiten. Aber ich will ihm nicht noch mehr Munition geben, als er sowieso schon hat, weil ich weiß, dass ich Scheiße gebaut hab. Und trotzdem habe ich gehofft, dass er Gnade walten lässt.
»Es war doch nur ein Fehler, ein kleiner Fehler«, sage ich, will noch nicht aufgeben, obwohl ich in seinem Blick sehe, dass all mein Flehen nicht auf fruchtbaren Boden stoßen wird.
»Ein kleiner Fehler?« Er schüttelt frustriert den Kopf. »Selbst wenn ich gewillt wäre, Ihnen noch eine zweite Chance zu geben, sind mir die Hände gebunden. Sie haben sich mit ein paar mächtigen Männern angelegt.«
»Das ist es also? Sie knicken ein, weil irgendjemandem die Berichterstattung nicht gefallen hat?« Okay, vielleicht ist es nicht so schlau, an sein Berufsethos zu appellieren, ihn zu provozieren, aber tiefer kann ich gar nicht mehr sinken.
Wütend funkelt er mich an. »Wenn ich Sie wäre, Mädchen, würde ich die Klappe nicht so weit aufreißen. Bisher versetze ich Sie nur. Wenn Sie mich auch noch anpampen, haben Sie gleich Ihre Kündigung in der Hand.«
Schnell hebe ich die Hände, will ihn beruhigen, denn eine Kündigung wäre mein Todesurteil. Also mein berufliches Todesurteil. Aus der Provinz kann man sich wieder herausarbeiten, aber niemand würde mir einen neuen Job geben, wenn ich hier gefeuert werde. Medienleute reden. Das ist einfach so.
Ich seufze. »Ich will kein Öl ins Feuer gießen, aber eine Zeitung sollte doch unabhängig und frei sein und sich nicht nach den Wünschen von reichen Menschen richten.«
Spöttisch lacht er auf. »Mädchen, Sie haben überhaupt keine Ahnung von der Welt. Geld regiert sie. Und auch die unabhängige Presse hat Sponsoren und Investoren und ist auf Werbeverträge angewiesen.«
»So sollte es nicht sein.«
»So ist es aber. Und Sie haben jemandem ans Bein gepinkelt. Sie wussten es, bevor Sie die Story lanciert haben.«
»Aber Sie zerstören meine Karriere.«
Er zuckt mit den Schultern. »Eigentlich rette ich sie. Sie sind gut, Mädchen. Sie haben all das, was man braucht, um im Journalismus zu bestehen. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Sie können sich aus der Provinz wieder raus arbeiten. Aber momentan sind mir die Hände gebunden und ich kann nichts anderes tun, als Ihnen diese Chance zu geben. Nutzen Sie sie. Verschleudern Sie Ihr Talent nicht, seien Sie fokussiert, suchen Sie gute Storys, halten Sie aber die Füße still und machen Sie sich nicht noch mehr Feinde. Das ist alles, was ich für Sie tun kann.«
»Aber …«
»Kein aber. Sie sind raus.« Und auch wenn seine vorherigen Worte durchaus empathisch klangen, ist auch Stahl in seiner Stimme. Es gibt keine Hoffnung für mich, dass ich ihn umstimmen kann.
Ich nicke langsam, bevor ich sein Büro verlasse. Wie ein geprügelter Hund schleiche ich an meinen Schreibtisch, sehe die mitleidigen Blicke meiner Kolleginnen, aber auch manch triumphierendes Gesicht, weil es nun eine Konkurrentin weniger gibt. An meinem Schreibtisch angekommen, packe ich die wenigen persönlichen Dinge zusammen, bevor ich mich von den paar Menschen, die ich aushalten konnte, verabschiede und alle anderen ignoriere.
Als sich die Türen des Aufzugs hinter mir schließen, stelle ich mir vor, wie plötzlich alle jubeln und mit Konfettikanonen schießen, weil sie mich los sind.
Ich weiß, dass ich niemals einen Preis für die beliebteste Mitarbeiterin bekommen würde, aber dass sie sich freuen, wenn ich weg bin, passt mir irgendwie auch nicht.
Ich zucke mit den Schultern, fahre in die Tiefgarage und trete an mein Auto. Ich öffne den Kofferraum, lege den kleinen Karton, der ziemlich leer ist, hinein, starre auf alles, was sich in den zwei Jahren in dieser Redaktion an persönlichen Dingen angehäuft hat, und muss erkennen, wie leer mein Leben eigentlich ist. Ein Kaktus, den mir meine Mitarbeiter mal geschenkt haben, weil ich genauso prickelig bin wie dieser. Ein Foto von meinen beiden Katzen. Und ein halb aufgegessener Schokoriegel.
Mehr Persönliches gab es von mir nicht. Wie traurig.
Bevor ich mich in Selbstmitleid verlieren kann, steige ich ins Auto und fahre los. Los in eine ungewisse Zukunft. In der Provinz. Kill mich jetzt. Irgendjemand muss mir doch den Gnadenstoß versetzen.
* * *
In meinem kleinen Apartment nördlich von Downtown schließe ich die Tür auf. Sofort höre ich das sanfte Maunzen meiner beiden grauen Katzen, die sich an meinen Beinen reiben, als ich eintrete. Ich hocke mich hin, noch bevor ich die Tür geschlossen habe, streichele ihnen die weichen Köpfe. Ich will nicht sagen, dass damit alle Sorgen von mir abfallen, gewiss nicht, aber niemand kann noch genauso schlechte Laune wie vorher haben, wenn er eine Katze streichelt.
»Ihr Süßen, habt ihr mich vermisst?« Na ja, mich oder das Futter. Eins von beiden. Tun wir mal so, als ginge es um mich.
Die kleine Küchenzeile schließt sich direkt an die Wohnungstür an und ich hole ihr Futter aus dem Schrank, verteile es auf die beiden Schüsseln, wobei sie immer erst zusammen die eine Schüssel und dann die andere leer fressen, bevor ich mir ein Glas Wein einschütte und ans Fenster trete. Ich trinke einen Schluck, betrachte die Hochhäuser von Los Angeles. So hatte ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Ich war immer fokussiert, hatte immer nur ein Ziel vor Augen. Ich wollte Christiane Amanpour werden, wollte irgendwann von den großen Schauplätzen in der Welt berichten, wollte eine Kerbe hinterlassen.
Aber was ist aus mir geworden? Ich habe Yale mit Auszeichnung abgeschlossen, habe nach mehreren Praktika diese Stelle in Los Angeles bekommen. Bei einer der renommiertesten Zeitung des Landes! Und ich habe es versaut. Wenn ich vielleicht mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl vorgegangen wäre. Wenn ich vielleicht mehr Beweise gesammelt hätte, bevor ich meine große Klappe aufgerissen hätte, um aller Welt zu beweisen, dass ich es kann. Ich schüttele den Kopf. Das passiert eben, wenn man versucht, ein zu großes Stück vom Kuchen abzubeißen. Ein Stück, das einem nicht zusteht.
Alle meine Pläne für die Katz. Ich hatte mich schon auf dem journalistischen Olymp gesehen, beim Presseempfang des Weißen Hauses und auf CNN, wie ich zu den neuesten Entwicklungen am Supreme Court befragt werde. Aber wie sagt man? Hochmut kommt vor dem Fall.
Und der Fall ist tief.
Santa Rosa. Mitten im Nirgendwo. Okay, das stimmt nicht ganz, denn ist es nur eine Stunde bis San Francisco und auch nicht weit bis zur Landeshauptstadt Sacramento. Aber es könnte auch auf dem Mars sein. Denn aus der Metropole Los Angeles werde ich in die Bedeutungslosigkeit verbannt. Was kann in so einer Provinzstadt denn schon passieren? Das Treffen des Taubenzüchtervereins? Der Diebstahl einer Packung Kekse? Aber dort passiert doch nichts von Substanz.
Nichts, wofür sich mein Politikwissenschaftsstudium gelohnt hätte.
Ich sehe mich um, betrachte mein kleines Apartment. Meine Katzen, die im Eiltempo Futter verschlingen können, liegen in ihrem Kratzbaum und schlafen. Viel mehr machen die beiden auch nicht. Schlafen, fressen, sich kraulen lassen, bis sie keinen Bock mehr haben und wild mit dem Schwanz zu zucken beginnen.
Es ist ja nicht nur ein neuer Job, sondern auch ein neues Leben. Ein neues Leben, das ich beginnen muss, auch wenn es nicht meine eigene Entscheidung ist. Ich muss mir ein Apartment in Santa Rosa besorgen, muss mit Sack und Pack dorthin fahren und neu anfangen.
Okay, vielleicht hört sich das dramatischer an, als es ist. Denn die Menge an persönlichen Dingen im Büro ist ein Indikator dafür, wie es in meinem Apartment aussieht. Keine Bilder, keine Pflanzen, nur politikwissenschaftliche Bücher, ein paar populärwissenschaftliche sind auch dabei, und ein paar Klamotten. Kleidung, die zum Job passt, nichts Ausgefallenes. Man könnte geradezu sagen, dass ich ein bescheidenes Leben führe.
Es wird nicht lange dauern, all das einzupacken. Eigentlich habe ich Pläne, daher wollte ich mich nicht mit Klimbim belasten. Allerdings hatte ich gedacht, dass ein Umzug nach Washington oder New York der Grund sein würde, warum es besser ist, auf leichtem Fuß zu leben. Dass es mich mal nach Santa Rosa verschlagen würde, wäre mir im Traum nicht eingefallen. Seufzend mache ich meinen Computer an, öffne den Browser und sehe all die geöffneten Fenster, die mein Eintritt in eine höhere Gehaltsklasse sein sollten.
Stattdessen mache ich einen neuen Tab auf und suche nach Wohnungsangeboten an meinem neuen Arbeitsplatz. Das ist der Vorteil an einer unwichtigen Stadt wie Santa Rosa. Niemand will dahin, weswegen es viel Wohnraum gibt. In Los Angeles hätte ich so kurzfristig nie etwas gefunden, aber dort kann ich aus mehreren Annoncen auswählen. Ich rufe bei drei verschiedenen Vermietern an, mache Termine für den kommenden Montag, bevor ich in meinen winzigen Keller gehe und die Umzugskartons raussuche, die ich vor zwei Jahren hier abgestellt habe.
Es sind peinlich wenige, wenn ich das mal so sagen darf. Und einer wird schon voll sein mit Katzenkram.
Zurück in der Wohnung gieße ich mir noch mehr Wein ein, bevor ich mich daran mache, die Kisten zu füllen. Ich lasse Outfits für die nächsten paar Tage draußen, aber alles andere wandert in die Kartons. Die Katzen öffnen kurz ihre Augen, bevor sie sich auf den Rücken rollen, schnurren und weiterschlafen. Ich schüttele den Kopf, weil es für mich so aussieht, als hätten Katzen doch das bessere Leben.
Wie viel sagt es über die Qualität des eigenen Lebens aus, das man nach einer Stunde all seinen weltlichen Besitz in zehn Kartons verstaut hat? Ich suche nach der Nummer des Anhängervermieters, die ich in meinem Handy gespeichert habe, und reserviere einen für Samstag. Dann reserviere ich ein billiges Motel für zwei Nächte und hoffe, dass ich am Montag schon mit Sack und Pack in ein neues Apartment einziehen kann.
Ich muss zwar erst in einer Woche in Santa Rosa sein, aber warum soll ich das Unausweichliche hinauszögern? Wenn ich frühzeitig da bin, kann ich mir schon die Stadt ansehen, kann ein Gespür für sie kriegen und vielleicht schon die ein oder andere interessante Geschichte finden. Wobei ich mir da nicht viel Hoffnung mache, denn was soll in der Provinz schon groß passieren?
***Wenn du weiterlesen möchtest:
E-Book Taschenbuch